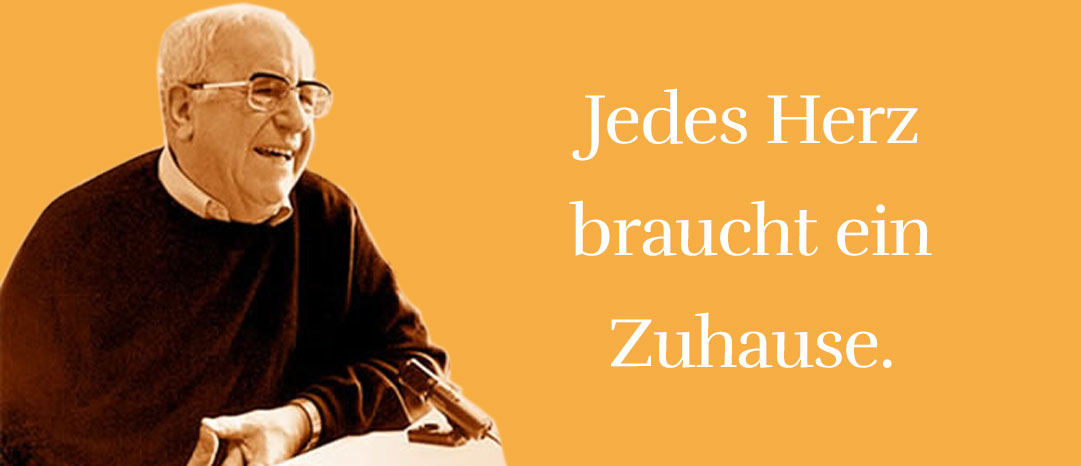In einem Dorf von einfachen, aber glücklichen Eltern geboren
»Ich wurde am 1. Juli 1922 in einer einfachen Bauernfamilie geboren. Vor mir war schon ein Mädchen da, und ich bin der älteste von drei Jungen. Wenn ich jetzt zurückblicke auf alles, was ich gesehen und gehört habe, wird mir bewusst: Um ein glücklicher Mensch zu werden, genügt es, in einem Dorf von einfachen, aber glücklichen Eltern geboren zu werden. Ich habe das Gefühl, dass ich alles bekommen habe, weil ich aus der Liebe von zwei Menschen geboren wurde, die mir allezeit Geborgenheit und Wärme geschenkt haben.
Mein Vater und meine Mutter sind die phantastischsten Menschen, die ich je gekannt habe. Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals wirklich böse gesehen zu haben. Sie werden sicher untereinander auch mal deutliche Worte gesagt haben, aber als Kind habe ich das nie gemerkt. Sie stehen in meinem Gedächtnis eingegraben als gewöhnliche, hart arbeitende, frohe, humorvolle Menschen. Eine Menge Schwierigkeiten fingen sie mit Humor auf.
Als Vater zu alt für die schwere Arbeit auf dem Land wurde, sind wir von Gruitrode nach Genk umgezogen. Das war für uns alle, aber vor allem für Vater ein schwerer Schlag. Er mußte das vertraute Fleckchen Erde verlassen, und wir verloren unser Dorf. In Genk hat Vater zwar noch etwas Landwirtschaft betrieben, aber ohne Erfolg. Doch klagte er nie, auch nicht, als er während des Krieges sein Pferd verlor. In Genk gingen später meine zwei jüngeren Brüder ins Bergwerk.
Mutter hatte mit vier Kindern und der Arbeit auf dem Hof mindestens so viel zu tun wie Vater. Ich rieche noch den Duft von frischgebackenem Brot und Buchweizenkuchen, ich höre noch ihre Stimme, ich sehe noch ihr Lachen, denn sie hatte viel Sinn für Späße. Sie war eine ungewöhnlich mutige Frau. Ich erinnere mich , als im Krieg die Deutschen näher rückten und alles in die Flucht schlugen, wie sie ihre Familie in den Keller brachte, dort seelenruhig die Spielkarten herausholte und eine Partie spielte.«

Drei Monate auf der Flucht im Krieg
»Als ich [1940, bei Kriegsausbruch in Belgien] aus der Internatsschule nach Hause kam, hörte ich, dass sich alle jungen Männer zwischen 16 und 30 Jahren melden müssten. Da blieb für mich und meinen jüngeren Bruder kaum eine Wahl. Entweder wir mussten fliehen, oder wir wurden festgenommen. Wir entschieden uns zur Flucht und zogen auf uralten Fahrrädern los. Mutter gab uns zwei Brote, einen Schinken und fünfzig Franken mit. Wir setzten auf einem Floß über den Kanal und flohen nach Süden. Die ersten drei Wochen saßen wir auf den Rädern. Während der Flucht machten wir schreckliche Dinge durch. Der Schinken und die fünfzig Franken waren schnell weg. Wir erlebten furchtbare Bombardierungen. Die Menschen, die wir trafen, waren voller Angst.

In einer Nacht mussten wir über die Brücke in Rouen. Es schien wie eine Apokalypse: weinende Menschen, fluchende Soldaten, Pferdewagen, Lastwagen voller Soldaten, Motorräder, Fahrräder, Mütter mit Kinderwagen. Todmüde haben wir irgendwo auf einer Wiese geschlafen und Kühe gemolken, um etwas zu trinken zu haben. Später sind wir mitten in der Nacht auf einen Güterzug geklettert. Seine Spitze zeigte nach Süden, nach einer Weile fuhr er los. Später, auf einem Bahnhof, als es bereits Tag war, wurden wir aus dem Zug geholt. Man nahm uns die Räder weg und steckte uns in einen gewöhnlichen Zug. In einem alten Dörfchen, in das man uns mit einem Bus brachte, konnten wir auf Stroh über einem Pferdestall bleiben. Dort haben wir drei Monate lang ausgehalten. Aber das Schlimmste war die mangelnde Verbindung mit Zuhause. Wir wussten nicht, ob unsere Eltern noch lebten. Darüber machten wir uns viele Sorgen.
Durch das Elend der drei Monate Flucht habe ich viel gelernt. Ich bin zum Beispiel gleichgültig geworden gegenüber materiellem Besitz. Ich habe Hunger und Durst gelitten, ich weiß, was Armut bedeutet. Immer wenn ich jetzt mit Obdachlosen, mit hilfsbedürftigen Menschen spreche oder Flüchtlinge im Fernsehen sehe, sehe ich das mit anderen Augen. Wer niemals am eigenen Leib erfahren hat, was arm sein heißt, kann Arme eigentlich nicht verstehen.«
Verloren im Geheimnis Gottes. Priesterweihe
»Es gibt Augenblicke, die dich tief prägen und die dir dein ganzes Leben bleiben. Solche Augenblicke erlebte ich vor Jahren an einem Tag im März [7.3.1948]. Die Sonne stand ganz früh am Himmel. Die Luft war so blau wie nie zuvor. Ich legte mich hin, ausgestreckt auf den Boden einer Klosterkapelle. Wir waren zu zwölft. Zwölf junge Männer ausgestreckt auf dem Boden. Wir hatten kapituliert vor einem Gott, der Liebe ist. Der alles von dir verlangt, um dir alles geben zu können. Wir fühlten uns in dem Augenblick unendlich weit weg, verloren im Geheimnis Gottes. Wir sahen Gott, wir spürten ihn. Es war, als ob wir in seinen Armen sicher, endgültig und für allezeit geborgen seien. Wir wurden zum Priester geweiht. Ein großes Heimweh nach diesem Augenblick tiefer Freude wurde uns ins Herz geschrieben.
Jesus stellte den Menschen in die Mitte. Er hat sich vor allem auf die Seite der Armen, Schwachen, Machtlosen gestellt. Dort ist auch mein Platz als Priester. Früher stellte man uns aufs Podest, wurden wir beweihräuchert, waren wir geradezu unnahbar, sakral. Aber ein Priester ist kein außerirdisches, unnatürliches Wesen. Ich bin zu hundert Prozent Mensch, mit allen menschlichen Begrenztheiten, Schwachheiten, Fehlern und Sünden.
In all den Jahren habe ich erfahren, dass man in seinem Leben verschiedene Male Priester wird. Priester wird man, bewusst oder unbewusst, jeden Tag, auch noch fünfzig Jahre nach der Weihe. Vor noch nicht allzu langer Zeit habe ich geschrieben, dass ich aufs neue ausgestreckt vor Gott am Boden liegen werde. Die Welt mag über mich hinweggehen und mich für verrückt erklären. Aber man vergisst, dass Gott dem Menschen ganz nahe ist, der vor ihm kapituliert. Ich bin für Gott und für die Menschen da. Ich will mich zur Verfügung stellen, um Gottes Liebe in dieser Welt sichtbar und fühlbar zu machen.«

Einsatz als junger Ordensgeistlicher
»Der Orden setzte mich bei Volksmissionen ein, wie sie damals üblich waren. Kamen wir in eine Pfarrei, dann entschied ich mich immer für das Viertel, das am wenigsten christlich war. Dort lebte ich so nah wie möglich bei den Menschen. Das war nicht immer einfach. Viele wollten mit Kirche und Pfarrern nichts zu tun haben. Aber ich blieb dabei, Menschen zu treffen und mit ihnen zu reden. Ich wollte ihnen nahe sein, ihr Leben teilen, ihre Sorgen und ihr Leid anhören und versuchen zu verstehen. Ihr Leben fesselte mich. Ich mochte die Menschen.
Wenn man mich früher manchmal fragte, wie viele Menschen ich denn zur Kirche zurückgebracht hätte, konnte und wollte ich darauf nicht antworten. Das war auch nicht das Wichtigste bei meiner Arbeit. Ich wollte in den Spuren Jesu gehen. So wie er, versuchte ich, Gott durch Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Güte spürbar und sichtbar zu machen. Wenn man Menschen nahe ist, wenn sie spüren, dass man ohne Hintergedanken viel für sie tut, dann geschehen kleine Wunder. Das habe ich manchmal bei Volksmissionen erfahren. So wie in Boom. Dort habe ich tagelang zwischen den Ziegeleiarbeitern in ihrem Zentrum gesessen. Sie haben mich durch ihre ungeschminkten Meinungen und durch ihr hartes Leben spüren lassen, dass ein Priester nicht allein von und für Gott da ist, sondern dass er wesentlich von und für Menschen da ist. Er ist da, um ein Wegweiser zu Gott zu sein.«
Eine völlig andere Arbeit als die Volksmissionen waren die Marienfahrten. Hier lag das Schwergewicht nicht darauf, in ein kirchenfremdes Milieu hineinzuwirken, sondern auf der lebendigen Förderung der Marienverehrung. Die Marienfahrten waren aufreibend. Jeden Tag dasselbe: Übertragungswagen fertig machen, Akkus für die Lautsprecher aufladen, Menschen begegnen, Andachten für Kranke, Alte, Behinderte halten, Schulen besuchen, Prozessionen und Abendanbetung leiten, Beichte hören und predigen. Phil Bosmans ging ganz in dieser Aufgabe auf. Bis er im Juni 1954 erschöpft zusammenbrach.
Eine Bewegung zur Kultur des Herzens
»Bond Zonder Naam [d. h. Bund ohne Namen] ist eine Bewegung zu einem neuen Lebensstil, zur Förderung des Herzens in allen Bereichen menschlichen Lebens. In einer Welt von Technik und Wissenschaft, von Computern und Robotern für Menschenwürde und menschliche Werte einstehen. In einer Welt von Verschmutzung kosmischen Ausmaßes sich einsetzen für die Bewahrung einer sauberen, natürlichen Umwelt. In einer Welt von Gewalt eintreten für Gewaltlosigkeit und Frieden. In einer Welt von Misstrauen und Hass sich einsetzen für Liebe und Freundschaft.
Bond Zonder Naam versucht Menschen wieder ein Zuhause zu schaffen, kleine Oasen für Menschen im Dschungel. Bond Zonder Naam ist ein stiller, hartnäckiger Versuch von Tausenden gewöhnlicher Menschen, um diese Welt wieder bewohnbar zu machen. Alles steht und fällt mir der ›Kultur des Herzens‹. Wenn diese Kultur fehlt, fehlt jegliche Kultur.
Es geht um die Verteidigung von menschlichen Werten wie Güte, Freundschaft, Verträglichkeit, Vergebung, Mut, Vertrauen und Hoffnung. Aber auch und vor allem um die Verteidigung des kleinen und schwachen Menschen, der nur zu oft von Stärkeren ausgenützt wird. Es geht um Liebe. Jemand hat das Wort ›Liebe‹ tief in unser Herz geschrieben. Davon bewegt, setzen wir uns für andere ein und tun wir etwas gegen die schreiende Not von so vielen.«

Philosophie in Kurz-Texten
»Ich war noch nicht lange beim Bond Zonder Naam, da fing ich mit eigenen Spruchtexten an. Immer ging ich von dem Leitwort aus: ›Verbessere die Welt, fang bei dir selbst an.‹ Ich bin mir klar: Neunzig Prozent von allem Leid in der Welt fügen die Menschen sich selbst und einander zu. Darum ist es nicht richtig, das Schlechte immer beim anderen zu suchen. Jeder will die Welt verbessern; aber meistens will er damit beim Nachbarn anfangen.
Es ist auch nicht gut, alle Schuld auf Institutionen oder auf den Staat zu schieben. Der Staat ist zwar ein schwerfälliges Gebilde, ein großer Elefant, der auf kleine Grashalme keine Rücksicht nimmt. Aber ihm alle Schuld anzulasten, ist ein allzu bequemes Alibi für Leute, die viel reden und wenig die Ärmel hochkrempeln. Es sind die Menschen, die sich selbst und so die Welt besser machen müssen. Ich sage: Kein Staat kann einen Kranken besuchen, Strukturen können nicht mit einem Behinderten spazieren gehen. Aber wir Menschen, wir können das.
So ein Spruch kommt einem manchmal direkt über den Weg gelaufen. Das erlebte ich ganz deutlich bei dem Wort: ›Menschenskind, ich hab‘ dich gern!‹ In meiner Limburgischen Heimat gebraucht man das Wort ›menslief‹ [etwa: Menschenskind] zigmal am Tag, es ist ein Allerweltswort. Eines Tages fuhr ich aus der Limburger Gegend nach Antwerpen zurück. Die Gespräche in den vergangenen Stunden gingen mir noch durch den Kopf. Auf einmal wurde mir das Wort ›menslief‹ ganz neu bewusst. Was für ein wunderbares Wort ›lieber Mensch‹. Wie viel Wärme und Zuneigung spricht daraus! Als ich unter der Autobahnbrücke in Beringen durchfuhr, war der Spruch geboren: ›Menschenskind, ich hab dich gern‹: Ich weiß es noch gut. Ich wollte, dass den Menschen bewusst wird, was sie eigentlich sagen, wenn sie gedankenlos »menslief‹ sagen: Du bist ein lieber Mensch, ich hab dich gern, ich halte große Stücke von dir, ich hab dich lieb.«

Die Wurzel der Bosmans-Bücher: Vitamine für das Herz
»Ich kam auf die Idee eines telefonischen Ansagedienstes, als ich hörte, dass man sich per Telefon sein Horoskop für den Tag oder die Woche holen kann. Ich fragte mich: Kann man nicht etwas Ähnliches für Menschen tun, die in der Klemme sitzen, die mutlos und verzweifelt sind, die ein gutes Wort brauchen? Die Initiative schlug ein. Die Nummer ›Vitamine für das Herz‹ gehörte zu den am meisten angerufenen Telefondiensten.
Weil so viele Menschen nach den Texten der ›Vitamine für das Herz‹ fragten, kam eines Tages 1971 Johan Ducheyne vom Verlag Lannoo mit dem Vorschlag, daraus ein Buch zu machen. So kam es, dass im September 1972 die erste Auflage in Belgien erschien. Das Ende der Geschichte ist bekannt. ›Menslief, ik hou van je‹ ist ein Bestseller geworden. Im niederländischen Sprachraum wurden mehr als 800 000 Exemplare verkauft, 57 Auflagen gedruckt. Das Buch wurde in 30 Sprachen übersetzt. Die deutsche Ausgabe ›Vergiss die Freude‹ nicht wurden über eine Million Exemplare verbreitet.
In ›Menslief, ik hou van je‹fasste ich in Worte, was die meisten Menschen denken und fühlen. Es war immer meine Absicht, Menschen mit einem Wort des Trostes und der Ermutigung zu helfen. Alle meine Texte entstanden aus der täglichen Konfrontation mit der fundamentalen Ohnmacht so vieler Menschen, in dieser Welt glücklich zu sein. Die Menschen erkannten sich selbst und ihre Situation in dem, was ich schrieb. Darin liegt vielleicht der tiefste Grund des Erfolgs, der mich selbst überrascht hat.
Eine Mutter erzählte mir mal, dass sie regelmäßig ein Stückchen in ›Menslief, ik hou van je‹ gelesen hätte. Dazu setzte sie sich immer ganz ruhig in einen Sessel. Eines Tages ist sie mit dem Buch auf dem Schoß eingeschlafen. Da lief ihr kleiner Sohn zum Vater, um ihm zu sagen, dass die Mama mit Phil Bosmans eingeschlafen sei. Eine schöne Geschichte.«

Es geht nicht um Phil Bosmans, sondern um die Botschaft
»Es besteht die Gefahr, dass man aus mir ein Idol oder, noch schlimmer, einen halben Heiligen macht. Das will ich nicht, denn das bin ich nicht. Ich habe mal geschrieben: Wenn es Gerechte und Sünder gibt, dann habe ich auf der Seite der Sünder zu stehen, weil ich ein Sünder bin.
Es geht nicht um Phil Bosmans, sondern um die Botschaft. Steht meine Person im Mittelpunkt, dann ist mein Liedchen schnell zu Ende gesungen. Aber das Lied, das ich singe, ist ein Dank für alles Schöne und Gute im Leben. Ich rede, schreibe und singe über Dinge, die nicht mehr so selbstverständlich sind und die man in keinem einzigen Warenhaus findet, weil sie nicht zu kaufen sind. Liebe, Freundschaft, Optimismus, Verträglichkeit, Freude, Frieden und Vertrauen machen die Kultur des Herzens aus und können der Welt ein neues Gesicht geben.
Persönlicher Erfolg, das genießt man selbst. Im Evangelium steht nirgendwo etwas über persönlichen Erfolg, wohl aber darüber, dass man Frucht bringen soll. Und wir wissen, dass die Früchte von anderen gegessen werden. Darum will ich wie ein Baum sein, der Früchte gibt, ohne zu fragen, wer sie isst. Und wenn man von den Früchten eines Baumes redet, darf man nicht vergessen, auf seine Wurzeln zu schauen, denn da kommt alles her. Ich bin in der Botschaft des Evangeliums verwurzelt, und die habe ich gratis bekommen.«

Kampf um Standplatz für Menschen ohne Rechte: Roma
Weihnachten 1973 sollte Phil Bosmans nie vergessen. Die Roma hatten sich am Nordhafen von Antwerpen niedergelassen, um Weihnachten zu feiern, aber die Polizei stand bereit, um sie zu verjagen. Er hatte das Fernsehen verständigt und sagte dem Bürgermeister, dass das Publikum einen ganz schlechten Eindruck von der Gastfreundschaft Antwerpens bekommen würde, wenn die Roma an Weihnachten vertrieben würden. Das Fernsehen kam, und schließlich durften die Roma bis nach dem Fest bleiben. Aber dann verliefen alle Gespräche und Briefe mit den Behörden ohne Ergebnis. Es blieb allein eine energische Aktion übrig.
„Wir haben im November 1974 in Mortsel ein Gelände gepachtet und auf eigene Kosten mit den notwendigen Installationen versehen. Die Bewohner von Mortsel waren empört, als sie hörten, dass Rom-Leute kommen würden. Auch die Ortsbehörde war keineswegs begeistert. Und ich hatte nicht einmal eine Baugenehmigung. Ich hatte wiederholt darum gefragt, aber sie vergaßen immer, das zu besprechen. Nachdem ich sowohl das Innenministerium als auch die Provinz und die Gemeinde Mortsel benachrichtigt hatte, fing ich mit den Arbeiten an. Ich schrieb ihnen, wenn sie beabsichtigten, die Arbeiten zu stoppen, sollten sie diese Absicht ruhig haben. Ich würde auf jeden Fall weitermachen.
Später habe ich gehört, dass der Innenminister den Regierungspräsidenten der Provinz Antwerpen abends angerufen hätte. Er sollte der Gemeinde Mortsel mitteilen, dass sie mich beginnen lassen sollten. Der Minister sah das Projekt als ein Experiment an und wollte sehen, wie es ausginge. Das Gelände war vorbereitet, und am 10. November 1974 bekamen vier Rom-Familien in Mortsel einen festen Standplatz. Wenige Monate später wurden die Roma ganz offiziell als Fremde anerkannt, was wir mit Briefen und Anträgen nicht erreicht hatten. Das Tor zu einem menschenwürdigen Leben lag offen vor ihnen.«

Ein Flüchtling aus Südafrika, der in Belgien nicht existieren durfte
 »Samba, ein schwarzer Junge aus Südafrika, wurde von Mike, einem britischen Matrosen, in einem Schiff versteckt und fuhr wochenlang über die Ozeane. Dann wurde er auf dem Kai in Antwerpen ohne Papiere abgesetzt und bekam von Mike etwas Geld. Weil er vor dem Gesetz nicht existierte, landete er im Gefängnis. Dort habe ich ihn getroffen. Er lag auf seinem Bett in Gefängnisklamotten, die ihm überhaupt nicht passten. Tief verstört, mit großen traurigen Augen in seinem schwarzen Gesicht. Ich kann die Angst nicht vergessen, die über seinem ganzen Wesen lag.
»Samba, ein schwarzer Junge aus Südafrika, wurde von Mike, einem britischen Matrosen, in einem Schiff versteckt und fuhr wochenlang über die Ozeane. Dann wurde er auf dem Kai in Antwerpen ohne Papiere abgesetzt und bekam von Mike etwas Geld. Weil er vor dem Gesetz nicht existierte, landete er im Gefängnis. Dort habe ich ihn getroffen. Er lag auf seinem Bett in Gefängnisklamotten, die ihm überhaupt nicht passten. Tief verstört, mit großen traurigen Augen in seinem schwarzen Gesicht. Ich kann die Angst nicht vergessen, die über seinem ganzen Wesen lag.
Wir haben ihn aus dem Gefängnis geholt und in der Arbeitsstätte MiN [d. h. Menschen in Not] aufgenommen. Das durfte nicht sein, denn er war illegal da. Er sollte das Land verlassen. Das dauerte Jahre. Alle möglichen Untersuchungen fanden statt. Eine lange Geschichte. Als wir nicht nachgaben und sagten, ihn notfalls zu verstecken, gab der Minister nach, und Samba bekam eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Samba war ein sanftmütiger, äußerst sensibler junger Mann. Er arbeitete ordentlich und lernte Niederländisch. Jetzt ist er verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Gambia, dort hat er eine Schreinerei, in der er junge Leute von der Straße holt und ausbildet.«
Das Auffangzentrum »De Stobbe« in Antwerpen, ein umgebautes ehemaliges Kloster
Über die Entstehung von »De Stobbe« (d. h. der Baumstumpf) sagt Phil Bosmans:
»In unserem Land gab es damals fast 300.000 Familien mit einem Elternteil, davon mehr als 25.000 alleinstehende Mütter mit drei oder mehr Kindern. Meistens hatten sie eine zerbrochene Ehe und qualvolle Familienverhältnisse hinter sich. Viele dieser Frauen standen mit ihren Kindern verzweifelt auf der Straße.
Im November 1987 hörte ich, dass in Antwerpen ein Kloster leer stand. Mitten in einem Wohnviertel und doch ganz ruhig, etwas von der Straße entfernt. Es war ausgezeichnet geeignet für die Aufnahme von Frauen und Kindern. Nur der Kaufpreis, neun Millionen belgische Franken, war für uns unbezahlbar. Als die Eigentümer, die Kleinen Schwestern von der Himmelfahrt, hörten, wofür das Kloster dienen sollte, drückten sie den Kaufpreis auf sechs Millionen. Anfang Dezember 1987 habe ich mit der Provinzialoberin telefoniert und ihr gesagt, dass ich die ursprüngliche Funktion des Klosters, nämlich Dienst für die Armen, bewahren wollte und dass die einfachen Menschen das alles einmal mit ihren Spenden bezahlt hätten. Wenn ich bezahlen müsste, würden die einfachen Leute zweimal zahlen müssen. Und das wäre doch nicht nötig.
Die Oberin legte es dem Provinzrat vor. Einige Tage später bekam ich das Kloster gratis und noch eine Schwester dazu. Ein fantastisches Geschenk! Nachdem wir nun das Kloster hatten, konnten wir mit dem Umbau beginnen, denn der war nötig, wollten wir von den Behörden anerkannt werden. Mehr als ein Jahr hat der Umbau eines Klosters zu einem Zentrum für Mütter mit Kindern gedauert. Am 26. Januar 1990 wurde ›De Stobbe‹ offiziell eröffnet. Frauen und Kinder finden hier mehr als eine Unterkunft, Ruhe und Sicherheit. Ihnen stehen Begleiterinnen zur Seite, die ein Gespür für das haben, was ihnen bisher fehlte und was sie dringend brauchen. Gemeinsam tun sie Schritte in ein neues Leben.«

In seinem Arbeits- und Schlafzimmer
»Es geschieht gelegentlich, dass mich Besucher beinahe mitleidig anschauen, wenn sie mich hier in meinem Zimmer sehen. Manche wagen zu fragen, wie ich es hier aushalte, und weisen auf mein Honorar aus den Bestsellern hin. Ich antworte darauf, dass ich nicht glücklicher wäre, wenn ich in einer tollen Villa lebte. Und mit dem Erlös aus meinen Büchern versuche ich anderen zu helfen. Eigentlich ist es ganz einfach. Heute scheint die Sonne, und die Vögel zwitschern, und wenn die Menschen jetzt noch gut zueinander wären, dann ist alles in Ordnung.«
»Der Materialismus trifft den Menschen in der Wurzel seiner Existenz. Er ist die Ursache für die Verdrängung des Geistes. Der Materialismus vergewaltigt das Denken, Fühlen und Reden. Er ist die Ursache von viel Korruption. Wir haben materiellen Wohlstand über menschliches Wohlergehen gesetzt und damit das Glück auf den Kopf gestellt. Wollen wir glücklich sein, dann müssen wir alle animalische Habgier aufgeben. Der große Unterschied zwischen Wohlstand und Wohlergehen liegt darin, dass Wohlstand ausschließlich auf Dinge ausgerichtet ist, während Wohlergehen sich auf Menschen bezieht. So kommt es, dass arme Menschen manchmal glücklich sind und steinreiche unglücklich.
Ich frage mich manchmal, warum es in unserer so wohlhabenden Gesellschaft nicht mehr glückliche Menschen gibt. Es kommt aus einer verkehrten Blickrichtung. Sie halten Ausschau nach Dingen, aber mit leblosen Dingen kannst du dir keine Liebe eintauschen. Würden die Menschen mit dem Herzen sehen, würden sie besser sehen.«

Verliebt in Clowns
»Ich habe auch eine große Vorliebe für Clowns. Ich fand, dass ich von ihnen viel zu lernen hätte. Folglich bekam ich mit der Zeit eine ganze Versammlung von Clowns geschenkt. Aber den schönsten Clown bekam ich in einem Gefängnis von Caracas. Das Gemälde war noch feucht, und das Gesicht des Clowns stellte das Gesicht des Gefangenen dar. Es war ein Meisterwerk. Ich sah darin die ganze Traurigkeit Südamerikas. Später begann ich über Clowns zu schreiben, kleine Texte. Hier ist einer:
Ein Clown ist einer, der alle Traurigkeit relativieren kann, einer, der immer und ausschließlich für andere da ist. Er kann lachen, wenn er weint. Er kann weinen, wenn er lacht. Ein Clown schlüpft in die Haut derer, denen alles schief geht, die sich immer täuschen, aber die überleben können, weil der Clown ihnen hilft, über ihr eigenes Elend zu lachen. Jeder Mensch ist so ein seltsames Wesen, eine Art Clown. Er muss lernen, durch seine Tränen hindurch zu lachen.
Manchmal fragt man mich, ob ich von den Kämpfen nicht müde, ob ich nie pessimistisch geworden bin. Das ist selten. Ich bin zwar müde, und es kam auch vor, dass ich es leid war. Aber dann flüchtete ich mich in meinen Kräutergarten und arbeitete, bis ich schwitzte. Dann war alles wieder leichter. Diese Erfahrung regte mich zu dem Spruch an: ›Die Hände gebrauchen erleichtert den Kopf.‹«
Abschied
1991 hatte Phil Bosmans seine Verantwortlichkeiten im Bond Zonder Naam an Jüngere übergeben. Frans Van Oudenhoven (auf dem Foto mit Phil Bosmans) wurde sein unmittelbarer Nachfolger. Über diesen Abschied schreibt er:
»Ein Weg für andere sein und dann in Stille abtreten. Das ist das Leben. Das war mein Traum. Denn wenn Menschen den Weg kennen und gehen, kann der Weg vergessen werden. Ich will Bond Zonder Naam loslassen in die Hände von anderen. Sicher, das tut ein bisschen weh. Es ist wie ein Kind, das man weggibt. Aber ich will konsequent sein. Die Erfahrung bei vielen Bewegungen lehrt: Wenn man alt geworden ist und nicht loslassen kann, dann erstickt man eine Bewegung. Vergänglich sein ist das Los von allem, was lebt. Man bekommt gerade so viel Zeit, um für andere Menschen gut zu sein und um ihnen einen Weg zu zeigen zum Licht, zur Liebe, zu ein wenig Glück, zu Gott.«
1994 erleidet Phil Bosmans einen Schlaganfall, von einem Augenblick zum anderen kam er in eine andere Welt. Er wurde vom Spielfeld abberufen. Zurück bleibt eine halbseitige Lähmung. Dazu sagt er:
»Ich bin, körperlich gesehen, nur noch ein halber Mensch. An eine solche Lähmung kann man sich nie gewöhnen. Nichts oder nur noch wenig tun zu können ist meine größte Qual. Vierzig Jahre lang habe ich Menschen Mut gemacht, habe gesagt und geschrieben, dass sie sich selbst annehmen sollten, so wie sie waren, jung oder alt, gesund oder gelähmt. Jetzt musste ich selbst praktizieren, was ich all die Jahre geschrieben hatte. Jetzt musste ich lernen, mit meinem Alter und mit meiner Behinderung zu leben, mit der Tatsache, dass ich nur noch wenig kann. Wenn ich nachts träume, dann träume ich, dass ich kerngesund bin. Werde ich dann am Morgen wach, ist der Arm immer noch lahm und das Bein immer noch kaum zu bewegen. Man sucht sich das nicht aus, krank und behindert zu sein. Das Leiden und das Kreuz sind niemals weit weg.«

In Kassel aus Anlass des 75. Geburtstags 1997
Bei diesem Fest sagte Ulrich Schütz (auf dem Foto links neben Phil Bosmans):
»Unvergesslich bleibt die erste Begegnung. Das ist bei einer großen Liebe nicht anders als bei einer langen Freundschaft. Bei meinem ersten Besuch in Antwerpen (1976) sagte er zu mir irgendwann einmal beim Autofahren, mitten im Großstadtverkehr, und das ist mir so unvergesslich geblieben: ‚So viele leidende, verzweifelte Menschen wenden sich an mich, als ob ich ihre Not wegzaubern könnte. Aber das kann ich nicht. Ich bin nicht der große Wundermann. Ich bin nur ein kleiner Mensch, nur eine kleine Glasscherbe, durch die die Sonne scheint.«
Er vergleicht sich manchmal mit einem kleinen Kobold, der den Leuten in den Ohren liegt – immer mit der stummen Frage nach dem Herzen. Oder vergleicht sich sogar mit einem kleinen Stückchen Glas, in dem sich die gewaltige Sonne bricht. Dann wäre diese kleine Rede sozusagen eine ›Laudatio auf eine Glasscherbe‹. Eigenartig, wie etwas Unscheinbares durchlässig werden kann für ganz Großes, wie sich in etwas ganz Kleinem unfassbar Großes spiegeln kann. Pater Bosmans hat es immer zu den kleinen Menschen hingezogen, zu den Leuten, die nicht viel zu sagen und die doch viel zu tragen haben. Sein Credo, das wir gewiss auch auf ihn selbst beziehen dürfen, lautet: »Kleiner Mensch, für mich bist du groß!« In seinem »Letzten Gebet« heißt es:
»Ich bin ein kleines Stückchen Glas, deine Liebe soll den Menschen darin leuchten. Ein Stückchen Glas, so manches Mal vom Alltag verstaubt, verdreckt von den Stürmen des Lebens. Aber jedes Mal hast du es wieder siebzig mal siebenmal rein gewaschen im warmen Regen deiner Barmherzigkeit, und du hast es zärtlich in deine Sonne gelegt, damit es leuchtender denn je mitspielt im ewigen Spiel der Liebe zwischen dir und den Menschen. Gott, aus Scherben machst du Spiegel deiner Liebe.«
»Mein tiefster Wunsch, Menschen glücklich machen.«
»Um ein bisschen glücklich zu sein, um ein bisschen Himmel auf Erden zu haben, musst du dich mit dem Leben versöhnen, mit deinem eigenen Leben, wie es nun einmal ist. Du musst Frieden machen mit deinem Gesicht, das du dir nicht ausgesucht hast, mit deinem Leib, der nicht immer so will, wie du gerne möchtest, Frieden mit den Menschen um dich herum, mit ihren Fehlern und Schwächen.
Wenn wir glücklich sein wollen, müssen wir einen Preis bezahlen. Der Preis für unser Glück: dass wir uns selbst geben. Das Glück ist wie ein Schatten: Es folgt dir, wenn du nicht daran denkst, als Schatten deiner Liebe. Das Glück ist wie ein Echo im Grunde deines Herzens: Es antwortet dir auf die Gabe von dir selbst.
Mein tiefster Wunsch ist, Menschen glücklich zu machen. Aber ich weiß und habe es oft genug erlebt: Wenn ich entmutigt und enttäuscht dasitze, wenn auch bei mir alle Lichter ausgehen, kann ich keinem Menschen mehr helfen. Ich will glücklich sein, um andere glücklich zu machen. Das Glück, das mir fehlt, ist das Glück der anderen.
Gott sagt: Wenn ich sehe, dass die Menschen glücklich sind, bin ich am Ziel. Der Sinn meiner Schöpfung ist das Glück der Menschen. Das Heimweh nach dem verlorenen Paradies ist dem Menschen ins Herz geschrieben. Das Paradies wird wiederkommen, damit die Menschen wieder glücklich werden.«
Gottesdienst beim Goldenen Priesterjubiläum 1998
»Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass nicht ich, sondern ein anderer es war, der mich bewegte. Ich war guten Willens, und eines Tages hatte ich alles gegeben, ohne recht zu wissen, was das alles mit sich bringt. Gott hat mich damals ernst genommen und mich – oftmals gegen meinen Willen – auf Wege voller Risiko geführt, um Dinge zu tun und durchzuführen, die mir zu schwer waren und die ich lieber anderen überlassen hätte. Ich wurde mit meiner großer Schwachheit und tiefen Armut konfrontiert, mein ganzes Priesterleben lang fühlte ich meine ganzes Priesterleben lang fühlte ich meine fundamentale Ohnmacht.
›Gott, meine Oase‹ habe ich irgendwann einmal geschrieben. Aber wie oft und wie tief ich Gott auch als eine Oase erfahren habe, wo ich nach Hause kommen und wahre Geborgenheit finden konnte, es gab doch auch viele Wüstentage. Wirkliche Oasentage waren eher selten. Eigentlich lebte ich in dieser Welt wie in einer Wüste. Die Leere, das Ausgebranntsein, die Dürre in dir selbst und um dich herum. Die Verlassenheit.
Gott lässt dich manchmal eine Zeit lang los, liefert dich an dein kleines Menschsein und deine grenzenlose Ohnmacht aus. Dann kommen die rauen Wüstenwinde über dich. Du möchtest irgendwo nach Hause kommen und Geborgenheit finden. Aber Gott ist nirgends mehr. Und doch musst du dann weiter glauben und mit leeren Händen nach dem ungreifbaren Gott greifen. Du musst weiter bitten um lebendiges Wasser und um den Weg zur Quelle. Der geht gegen den Strom. Bis dann wieder der Tag kommt, da Gott dich aus der Wüste herausruft und dich die Wunder in seinem Garten genießen lässt, die Gaben seines Herzens, die Früchte seines Geistes.«
Zusammenfassung eines Lebens
»Loslassen können ist das Geheimnis. Ich habe manchmal gesagt, dass der, der loslassen kann, unter dem Verlust von nichts leidet. Wer sich selbst in Gott verliert, verliert nicht sich selbst, sondern verliert nur seine Grenzen. Loslassen ist nicht Gleichgültigkeit, heißt nicht, sich um das Schicksal anderer nicht zu kümmern. Im Gegenteil. Man legt sein Lebenslos in Gottes Hände. Viele Menschen sind erstaunt, dass ich meine Behinderung akzeptiere. Ich finde nur, dass ich jetzt beweisen muss, was ich mein ganzes Leben geschrieben und gesagt habe.
Sterben ist die äußerste Form von Loslassen. Aber über den Tod wird in allen Sprachen geschwiegen. Und doch steht der Tod mitten im Leben. An den eigenen Tod denken ist etwas Bereicherndes. Befreiendes. Man kann ihn akzeptieren, wenn man sich dem Geheimnis öffnet, das einen nach dem Tod erwartet. Wenn du alt wirst, weißt du mit absoluter Sicherheit, dass du auf den Rand deiner Welt zugehst und dass du eines Tages fallen wirst, schwindelerregend tief. Darauf sage ich: Lass dich fallen, denn du fällst in die offene Hand und in die zärtlichen Arme Gottes. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, der mich gern hat. So wird mein Sterben das Nach-Hause-Kommen eines Kindes zum Vater. Dann werden alle Wunden heilen, auch meine Behinderung, auch meine tiefste Wunde, der Tod. Dann wird das Leben endgültig beginnen.
Ich glaube an die Auferstehung. Gott hat Auferstehung in Geist und Herz jedes Menschen geschrieben, so wie er sie geschrieben hat in jedes Blatt jedes Baumes, der im Frühling jubelnd wieder zum Leben kommt. Ich glaube, dass ich auferstehen werde zu neuem Leben in einem Paradies voller Freude. Wenn ich in die Nacht des Todes eintrete, möchte ich sagen: Alles ist jetzt in Ordnung. Ich bin nicht tot. Ich bin nur am anderen Ufer. Alles wird ›Licht‹. Alles wird ›Liebe‹. Die Erde kann mir kein Leid mehr antun. In Gott sind alle Wünsche erfüllt. Ich kann nur dankbar sein. Ich bin im Frieden, denn ich bin geborgen in den Armen eines unendlich liebenden Gottes.«